Wir alle träumen Cyber-Träume
Vor dreißig Jahren erschien William Gibsons epochaler Science-Fiction-Roman „Neuromancer“
Das Geheimnis der Science-Fiction ist es, eine Welt zu erschaffen, von der man selbst nichts weiß.
Als William Gibsons Roman „Neuromancer“, der Auftakt zur gleichnamigen Trilogie (im Shop), im Juli 1984 in den USA erschien, gab es kein Windows, kein Google, kein Facebook, kein YouTube, kein Twitter, kein Linux, keine Chatrooms, keine Laptops, keine USB-Sticks, keine Blackberrys, keine iPhones, keine SMS. Als „Neuromancer“ erschien, konnte man das neue Album von, sagen wir, Culture Club oder Duran Duran als große schwarze Scheibe kaufen und E-Mails und Computernetzwerke – also die Vorstufen dessen, was später das World Wide Web, der „Cyberspace“, werden sollte – waren eine Feierabendbeschäftigung für eine Handvoll Informatiker und Militärs.
 „Tja, ist nicht mehr so wie früher“, wie es gleich zu Beginn von „Neuromancer“ heißt.
„Tja, ist nicht mehr so wie früher“, wie es gleich zu Beginn von „Neuromancer“ heißt.
Dreißig Jahre später kann man sich die Zeit, als wir noch analog lebten, kaum mehr vorstellen. In diesen Jahren hat sich jene Welt, in der mediale Inhalte untrennbar mit einem Träger verbunden waren, ob Stein oder Papier, Vinyl oder Zelluloid, mit erstaunlicher Geschwindigkeit aufgelöst, mit dem Ergebnis, dass heute praktisch alle Arbeitsprozesse und Alltagsvorgänge in irgendeiner Form an das Internet gekoppelt sind, über siebzig Prozent aller Bewohner der westlichen Industriestaaten täglich „online“ gehen. Dreißig Jahre später „Neuromancer“ zu lesen bedeutet also, sich vorzustellen, wie es wäre, das Wort „Cyberspace“ zum ersten Mal zu vernehmen. Denn William Gibson hat sich dieses Wort ausgedacht – und er hat damit den Rhythmus einer neuen Zeit vorgegeben.
1948 geboren, wuchs der „Erfinder des Cyberspace“ keineswegs in einem jener großen urbanen Zentren der USA auf, die später als außer Kontrolle geratene Kulisse für seine Geschichten dienen sollten, sondern in der Provinz von South Carolina und Virginia. Es war eine von zahlreichen Brüchen geprägte Zeit: Mit sechs Jahren verlor Gibson den Vater, mit fünfzehn wurde er in eine Privatschule nach Arizona geschickt, die er drei Jahre später, als seine Mutter starb, ohne Abschluss verließ. Um dem Militärdienst in Vietnam zu entgehen, zog er nach Kanada, wo er sich, neben Studium und Familiengründung, kopfüber in die „Gegenkultur“ stürzte und die Literatur jenseits der grellen Science-Fiction-Magazine seiner Jugend entdeckte. William S. Burroughs zeigte ihm, wie man einen Plot collagierte, Thomas Pynchon ließ die Tiefenstruktur der Welt erahnen, und J. G. Ballard wies auf die Notwendigkeit hin, kulturelle Artefakte zu dechiffrieren. Und dann, irgendwann in den späten Siebzigern, betrat Gibson eines Tages in Vancouver eine jener Videospielhallen, die damals der letzte Schrei adoleszenter Freizeitgestaltung waren, und machte eine folgenschwere Beobachtung:
„Ich hatte nicht viel Erfahrung mit Videospielen, und es war mir peinlich, eine dieser Spielhallen aufzusuchen, weil alle dort viel jünger waren als ich. Doch als ich dann hineinging, merkte ich an der Intensität ihres körperlichen Einsatzes, wie versunken diese Kids waren. Es kam mir vor, als wäre eines der geschlossenen Systeme aus einem Roman von Pynchon Wirklichkeit geworden: Eine Rückkopplungsschleife aus Photonen, die aus dem Bildschirm heraus in die Augen der Kids strömten, Neutronen, die durch ihren Körper flossen, und Elektronen, die durch den Computer flossen. Und diese Kids glaubten offensichtlich an die Realität des Raumes, den diese Spiele projizierten. Jeder, der mit Computern arbeitet, scheint einen intuitiven Glauben daran zu entwickeln, dass hinter dem Bildschirm ein wirklicher Raum existiert.“
Der Raum hinter dem Bildschirm … Ganz neu war das nicht; die „künstliche Realität“ war seit eh und je ein beliebtes Thema in der Science-Fiction. Autoren wie Philip K. Dick, Harlan Ellison, Daniel F. Galouye und Vernor Vinge hatten Geschichten geschrieben, in denen Simulationen unsere Welt bevölkern oder sich die Welt selbst als Simulation herausstellt, Stanislaw Lem hatte in seiner „Summa technologiae“ mit der „Phantomatik“ eine Art Philosophie des Virtuellen eröffnet, und der Disney-Film Tron hatte erstmals einen Eindruck vermittelt, wie es in einem Videospiel zugehen könnte. All diese Einflüsse schlugen sich in Gibsons frühen Kurzgeschichten „Johnny Mnemonic“ und „Chrom brennt“ nieder, in denen er die nicht allzu ferne Zukunft als Mischung aus High Tech und Low Life zeichnete: Eine Zukunft, in der sich gigantische Stadtlandschaften, „Sprawls“, über die Erde ausbreiten, in der sich „Cowboys“ in die Datenspeicher der Großkonzerne hacken, in der man sich per „Simstim“ in die Gefühlswelt anderer Menschen einloggt. Die Kurzgeschichten wurden erstmals in dem Science-Fiction-Magazin OMNI publiziert, und wer sie las, konnte das enorme erzählerische und visionäre Talent erahnen, das hier nach einer Stimme suchte. „Mir kam“, so Autorenkollege John Shirley, „bei der Lektüre als Analogie in den Sinn, wie ich Jimi Hendrix zum ersten Mal Gitarre spielen gehört habe. Nicht dass Gibson auch so ungestüm gewesen wäre – aber beide erweckten den Anschein, als ginge ihnen ein meisterhafter Ausdruck mühelos von der Hand, und beide hatten eine künstliche Stimme geschaffen, die ganz neu, wahrhaftig zeitgemäß und zugleich ihrer Zeit voraus war.“
Es waren diese scheinbare Mühelosigkeit und Künstlichkeit, die schließlich auch den Reiz des ersten Satzes von „Neuromancer“ ausmachten: „Der Himmel über dem Hafen hatte die Farbe eines Fernsehers, der auf einen toten Kanal geschaltet war.“ Der Satz gehört inzwischen zu einem der meistzitierten der modernen Literatur – völlig zurecht, ist er doch einer jener Sätze, die wie in einer Nussschale ein ganzes ästhetisches Universum beinhalten. Der entscheidende Satz des Romans jedoch, der Satz, der alles veränderte, fand sich erst einige Seiten später:
„Cyberspace. Eine Konsens-Halluzination, tagtäglich erlebt von Milliarden zugriffsberechtigter Nutzer in allen Ländern, von Kindern, denen man mathematische Begriffe erklärt …“
Auslöser kultureller Umwälzungen im Nachhinein exakt festzumachen ist, wie man weiß, eine müßige Angelegenheit – allzu oft verschmelzen Ursache und Wirkung miteinander, verliert sich das wirklich „Neue“ im Mahlstrom aus Diskurs und Interpretation. Aber es gibt gute Gründe anzunehmen, dass die Welt eine andere wäre, hätte William Gibson damals diesen Satz nicht – oder anders – geschrieben. Denn er hat damit unsere Vorstellung von dem, was geschieht, wenn wir die Computer zusammenschalten, von Anfang an in eine bestimmte Richtung gelenkt. Von Anfang an war klar: Der „Raum hinter dem Bildschirm“ lässt sich nicht auf irgendwelche materiellen Verschaltungen, auf Befehlszeilen, Datenbits oder elektrische Signale reduzieren, sondern er ist ein Ort, ein Kontinent, eine Welt. Eine Welt, die einer neuen Sprache, neuer Verkehrsformen bedurfte und diese gleichzeitig versprach, eine Welt, die es zu entdecken und gleichzeitig zu erzeugen galt. Und all die Informatiker und Ingenieure und Künstler, die Männer und Frauen, die in Garagen und stillen Kämmerlein und Instituten mit den „Neuen Medien“, am ersten Macintosh und an lokalen Netzwerken herumexperimentierten, lasen diesen Satz und dachten sich: „Wow, da müssen wir hin!“
William Gibson schrieb „Neuromancer“ auf einer Reiseschreibmaschine und kannte sich damals in etwa so gut mit Computern und Netzwerken aus wie jeder normalsterbliche Zeitgenosse: gar nicht. „Neuromancer“ und die Folgeromane strotzen nur so vor Techno-Speak und wissenschaftlich anmutenden Neologismen – und sind doch völlig unwissenschaftlich. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen in der Gemeinde der Science-Fiction-Autoren wollte Gibson uns nichts erklären, sondern uns ein Gefühl für die Zukunft geben: „Ich brauchte keine persönliche Erfahrung mit dem Personal Computer, um zu spüren, dass wir alle Hals über Kopf auf eine Interaktivität, eine Vernetzung unvorstellbaren Ausmaßes zurasten, auf einen Informationsfluss von unvorstellbarer Geschwindigkeit, Breite und Tiefe.“
Und so kann es kaum erstaunen, dass William Gibson nach all den Jahren, in denen wir der inflationären Ausdehnung dieses „Raumes hinter dem Bildschirm“ zusehen konnten – gleichsam der digitalen Version von Hubbles kosmischer Expansion – und sich unsere Art, miteinander zu kommunizieren und gesellschaftliche Bindung zu erzeugen, radikal verändert hat, heute als Prophet des Informationszeitalters verehrt wird. Und dass die Neuromancer-Romane, weltweit millionenfach verkauft, nicht nur ein neues literarisches Subgenre, den sogenannten „Cyberpunk“, geschaffen, sondern Eingang in wissenschaftliche Abhandlungen, philosophische Traktate und unzählige Phänomene der Popkultur gefunden haben.
.jpg) Doch wie es so schön heißt: Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. So dürfte einem 1990 geborenen Leser vieles in der Trilogie skurril anmuten: Bonn die deutsche Hauptstadt, die einem Nuklearangriff zum Opfer fällt? Die japanische Yakuza als dunkle Bedrohung im Weltwirtschaftskrieg? Gibson selbst hat es später als großes Defizit bezeichnet, dass in „Neuromancer“ immer noch der Ostblock existiert und AIDS keine Rolle spielt; er hat sich – abgesehen davon, dass man nicht sein Leben lang als „Erfinder des Cyberspace“ durch die Talkshows tingeln will – sichtlich unwohl gefühlt in seiner Haut als Science-Fiction-Autor und sich in den Jahren nach der Neuromancer-Trilogie bemüht, seine Geschichten immer mehr in Richtung Gegenwart zu verlagern. Ja, neueste Romane wie „Mustererkennung“ oder „Quellcode“ beschwören inzwischen gar keine Zukunft mehr, sondern beschreiben, so der Autor, „den Teil der Zukunft, der schon Gegenwart, aber noch nicht in Ihrem örtlichen Einkaufszentrum angekommen ist“, strecken die literarischen Fühler nach jenen aktuellen Prozessen aus, die tatsächliche und nicht nur scheinbare Veränderungen bedeuten, jenen Momenten, über die kein Historiker je berichten wird und die doch Historie erst ermöglichen.
Doch wie es so schön heißt: Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. So dürfte einem 1990 geborenen Leser vieles in der Trilogie skurril anmuten: Bonn die deutsche Hauptstadt, die einem Nuklearangriff zum Opfer fällt? Die japanische Yakuza als dunkle Bedrohung im Weltwirtschaftskrieg? Gibson selbst hat es später als großes Defizit bezeichnet, dass in „Neuromancer“ immer noch der Ostblock existiert und AIDS keine Rolle spielt; er hat sich – abgesehen davon, dass man nicht sein Leben lang als „Erfinder des Cyberspace“ durch die Talkshows tingeln will – sichtlich unwohl gefühlt in seiner Haut als Science-Fiction-Autor und sich in den Jahren nach der Neuromancer-Trilogie bemüht, seine Geschichten immer mehr in Richtung Gegenwart zu verlagern. Ja, neueste Romane wie „Mustererkennung“ oder „Quellcode“ beschwören inzwischen gar keine Zukunft mehr, sondern beschreiben, so der Autor, „den Teil der Zukunft, der schon Gegenwart, aber noch nicht in Ihrem örtlichen Einkaufszentrum angekommen ist“, strecken die literarischen Fühler nach jenen aktuellen Prozessen aus, die tatsächliche und nicht nur scheinbare Veränderungen bedeuten, jenen Momenten, über die kein Historiker je berichten wird und die doch Historie erst ermöglichen.
Die Neuromancer-Trilogie dagegen ist noch lupenreine Science-Fiction – bezeichnenderweise wählte Gibson als Metaplot die älteste SF-Story aller Zeiten: die von Frankensteins Monster –, und Science-Fiction „altert“ eben weniger gut als andere Genres. Was machen wir also in einer Zeit, in der wir ins „Netz“ gehen wie früher in die Kneipe, in der die „Cyberpunks“ ganz gutbürgerlich eine Partei gründen, in der die erste „Dotcom-Blase“ bereits geplatzt ist und man sich rührig bemüht, der „Informationsflut“ didaktisch beizukommen, mit der Neuromancer-Trilogie?
Ganz klar: Wir sollten sie immer wieder lesen.
Und wir sollten sie einsortieren in die Reihe jener großen Klassiker der Weltliteratur, die der Menschheit etwas über sich selbst erzählen – etwas, das so vorher noch nie erzählt wurde.
Im Laufe der Rezeptionsgeschichte wurde William Gibson immer wieder vorgeworfen, die virtuelle Welt, die er in der Neuromancer-Trilogie beschreibt, zu verherrlichen, weil sich seine Helden danach sehnen, die digitalen Räume nicht nur zu bereisen, sondern eins mit ihnen zu werden. „Der Körper war nur Fleisch. Und nun war Case ein Gefangener seines Fleisches“, heißt es in „Neuromancer“, und diesem Gefängnis der Körperlichkeit wird die grenzenlose Freiheit gegenübergestellt, die die Konsolen-Cowboys im unendlichen Raum der Matrix genießen. „Allzuoft“, so die Wissenschaftsjournalistin Margaret Wertheim, „verrät die cyber-religiöse Träumerei eine Tendenz, Verantwortung auf irdischer Ebene aufzugeben.“ Und tatsächlich: KI-Propagandisten und Theoretiker des „Posthumanen“ sahen und sehen in Gibson eine Art literarischer Referenz für eine paradiesische Zukunft, in der wir von der Bindung an einen physischen Körper befreit sein werden.
Ein Missverständnis. Natürlich sind die Neuromancer-Romane bevölkert von Personen, die in den Cyberspace geladen werden und bisweilen auch in die digitale Unendlichkeit eingehen, aber Gibson macht nie einen Hehl daraus, dass die virtuelle Person nicht die wirkliche Person ist, dass es in der Cyber-Welt, ja in jeder Art von „enhanced reality“, um ganz profane Machtfragen geht und dass – obwohl uns die KI namens Neuromancer vom Gegenteil überzeugen will – nicht alle Aspekte der Realität berechenbar sind.
Doch er macht sich auch keine Illusionen über die menschliche Natur. „Wir diskutieren diese Dinge“, so der Autor, „als wäre die Menschheit noch in einem vollkommen natürlichen Zustand. Wir haben alle Metall in unseren Zähnen – ich hätte sonst überhaupt keine Zähne mehr. Wir sind immun gegen Krankheiten, die früher Millionen von Menschen das Leben gekostet haben. Die Technologie verändert unsere Körper.“ Noch ist die Technik nicht mit unserem Körper verschmolzen, aber längst registrieren wir Softwareredundanzen mit zunehmender Ungeduld, verlangen wir nach ständigen „Updates“, erscheinen uns die Desktop-Computer, die wir benutzen, bereits jetzt schon erschreckend gestrig. Geben wir’s zu: Wir alle träumen Cyber-Träume. Wir wollen keine Windows-Fenster mehr, die uns ab und an einen Einblick gewähren – wir wollen Operatoren für den Grenzverkehr zwischen den Kommunikationswelten. Und man muss kein großer Visionär sein, um zu erkennen: Diese Operatoren werden erst Brillen sein und dann irgendwann ein Gerät, das an der Schnittstelle von Gehirn und Computer angebracht wird.
Was seine Extrapolationen betrifft, hat William Gibson immer strikt nachfrageorientiert gedacht: Niemand wird eine Zukunft, in der es Genindustrien, die Konstruktion neuer Lebensformen, nanotechnologischen Materieumbau und eine virtuelle Parallelrealität geben wird, aufhalten. Und niemand wird diese Zukunft verstehen. Wie einer von Gibsons Protagonisten sagt:
„Sachen gibt’s draußen. Geister, Stimmen. Warum auch nicht? In den Ozeanen gab’s Meerjungfrauen und all so ’nen Scheiß, und wir haben ein Silizium-Meer, nicht? Sicher, ist nur ’ne künstlich erzeugte Halluzination, an der wir alle gemeinsam teilzunehmen beschlossen haben, der Cyberspace, aber jeder, der einsteckt, weiß verdammt gut, dass er ein ganzes Universum ist. Und mit jedem Jahr wird’s ein bisschen voller da drin.“
In den Neuromancer-Romanen ist der Cyberspace eine Metapher für einen Raum, in dem die Hierarchien der Kommunikation nicht nur implodiert sind, sondern die Kommunikation selbst eine Form angenommen hat, die einem Angriff auf das zerebrale System gleichkommt. Und für einen Raum, der nichts mehr und schneller produziert als Vergangenheiten – vergangene Zukünfte.
Ein Raum voller Echos. „Man lese“, schreibt Jack Womack, „Gibsons Bücher, gerne mehrmals, und man wird feststellen, wie viele Bezüge es gibt auf Vorkommnisse und Begebenheiten, die sich zu nicht genau definierten Zeiten vor Beginn der Handlung ereignet haben, wie viele nostalgische Erinnerungen an Das-was-nicht-mehr-so-ist-wie-früher. Wie oft müssen Gibsons Figuren unterbewusst feststellen, dass sie etwas nachtrauern, für das sie keinen Namen haben. Als würden sie bis an ihr Lebensende verfolgt von Erinnerungen, nicht nur den eigenen, nein, auch fremden.“
Natürlich ist Gibson ein in der Wolle gefärbter Spannungsautor, der die Plot Points exakt setzt, die Genre-Konventionen in- und auswendig kennt und seiner Sprache eine atemberaubende Geschwindigkeit verleiht. Und doch bestechen die Neuromancer-Romane durch eine Tendenz zu Retardation und Kontemplation, zu den Geschichten hinter der Geschichte, dem Ereignis zwischen den Ereignissen. Immer wieder scheint die Erzählung den Atem anzuhalten, immer wieder entsteht eine frappierende Gleichzeitigkeit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, eine fragile Balance aus Erzähltem und Unerzähltem. Gibsons Helden sind Menschen, die zu einer immer schneller werdenden Musik tanzen, bis sie schließlich so schnell ist, dass niemand mehr mithalten kann; sie taumeln durch eine Welt, die unter ihren Füßen zerbröckelt, in der man den Dingen beim Verschwinden zusehen kann. Eine entgrenzte Baustelle, ein globales Transithotel. Und es genügt, aufmerksam Zeitung zu lesen – oder eben im Netz zu surfen –, um zu wissen: Wir bewegen uns auf diese Welt zu.
William Gibson wusste das von Anfang an. Und er wusste auch, dass diese Zukunft keinem erkennbaren editorischen Prinzip mehr folgen wird. Was gehört noch zusammen, was bildet ein Ganzes? Was hat Bedeutung, was keine? Was ist Zeichen, was bloß Rauschen? Wer schreibt das, wie man in der Stadtplanung sagt, „script of reality“, wenn man Dinge und Wesen Atom für Atom zusammen- und wieder auseinanderbauen kann, wenn jede Umgebung, jede Oberfläche eine Projektion sein kann?
Und vor allem: Was wird aus dem Menschen in einer solchen Zukunft? „Collagen von jemand anderem“, wie es im zweiten Teil heißt? Oder jene „Geister in der Maschine“, die sich im dritten Teil der Realität bemächtigen?
Kinder, denen man mathematische Begriffe erklärt … In der Neuromancer-Trilogie hat uns William Gibson erstmals in der Literaturgeschichte eine Vorstellung davon gegeben, was es bedeutet, wenn Medientechnologien im wahrsten Sinne des Wortes zu Bewusstseinstechnologien werden. Was es bedeutet, wenn diese Technologien „Welt“ produzieren: Längst sind Handys mehr als eine reine Weiterentwicklung des Telefons, sondern definieren unser Zusammenleben. Längst sind Navigationsgeräte oder WLAN-Netze mehr als bloße technische Orientierungsmittel, sondern strukturieren den Raum. Längst sind Computerspiele mehr als eine Freizeitbeschäftigung, sondern prägen unsere Fähigkeit, uns in fremde Situationen, in fremde Menschen hineinzuversetzen. Und längst ist das Internet, der Cyberspace, mehr als eine neuartige Form der Massenkommunikation – das Internet ist Kommunikation.
Der Cyberspace ist heute, dreißig Jahre nach William Gibsons „Neuromancer“, nicht mehr dort, er ist hier – da, wo wir gerade sind. Die andere, die neue Welt ist nun die, in der es keinen Netzanschluss gibt, in der das Handy nicht funktioniert, in der irgendjemand den Stecker gezogen hat.
Von dieser anderen Welt wissen wir kaum mehr etwas.
Beste Voraussetzungen also, sie neu zu erschaffen.
Sascha Mamczaks Buch „Die Zukunft – Eine Einführung“ ist im Shop erhältlich.

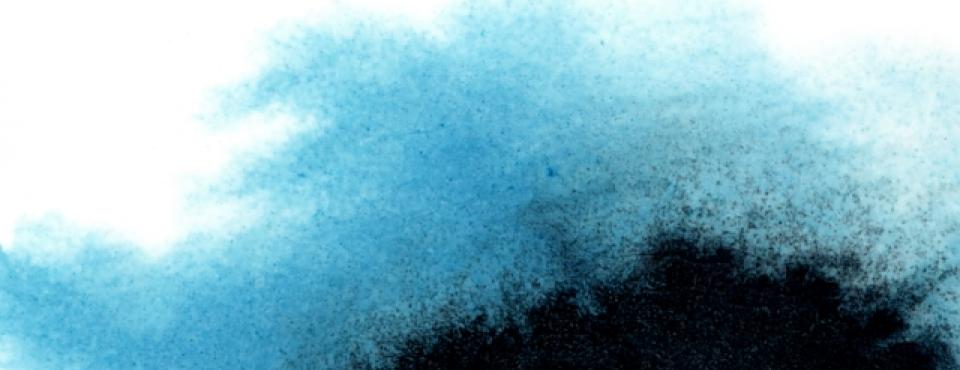

Kommentare
Genau das ist es: sie neu zu erschaffen
denn auch diese neue Welt wird wieder nicht so sein wie früher.
Aber das ist auch nicht wesentlich. Sie wird uns wieder einen oder mehrere Schritte vorwärts bringen (und manchmal führt auch ein Schritt zurück auf einen neuen Weg vorwärts).
Dann wird der Cyberspace die gute alte Zeit sein.
Und wennschon? Auch dann wird es Leute geben, die sich mit der Zukunft auseinandersetzen. Denn das ist nun mal die Blickrichtung.
Aber Zukunft braucht Herkunft (das hat einer gesagt, der klüger ist als ich). Und deswegen sei der Blick zurück gestattet und als wertvoll erachtet, den Blick nach vorn halte ich aber immer noch für wichtiger.